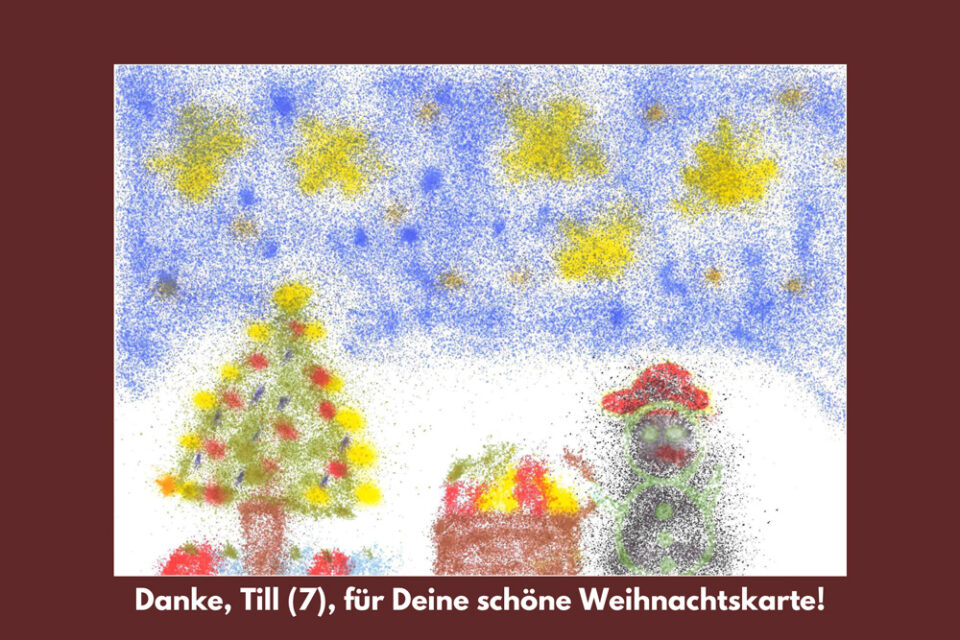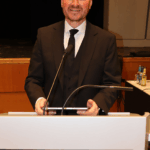
Rede zur Einbringung des Haushaltsplanentwurfs zum Doppelhaushalt 2026/2027 der Stadt Filderstadt
4. November 2025
Rede zum Volkstrauertag 2025
17. November 2025„Grußwort anlässlich der Tagung „Anspruch und Wirklichkeit“ – Gesellschaftspolitische Herausforderungen für die Gedenkstättenarbeit im Tagungszentrum Hohenheim“
14. November 2025
Grußwort
Tagung „Anspruch und Wirklichkeit“
Gesellschaftspolitische Herausforderungen für die Gedenkstättenarbeit
Tagungszentrum Hohenheim
Oberbürgermeister Christoph Traub
Sehr geehrter Herr Dr. Kuber,
sehr geehrte Mitglieder der Tagungsleitung,
sehr geehrte Referentinnen und Referenten,
sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
sehr geehrte Gäste dieser Abendveranstaltung hier im Raum und darüber hinaus – weltweit,
vielen Dank, dass ich heute hier zu Ihnen sprechen darf und dies im Rahmen einer Tagung, die mit Blick auf die Gedenkstättenarbeit unter dem Titel „Anspruch und Wirklichkeit“.
Ich gebe zu, beim ersten Lesen hat mich dieser Titel provoziert. Weil er in seiner Direktheit in Frage stellt, was wir tun. Diese Tagung findet statt aus Anlass des Auffindens der sterblichen Überreste von 34 Häftlingen des KZ-Außenlagers Echterdingen-Bernhausen vor 20 Jahren.
In unmittelbarer Nähe des Fundortes und des heutigen Ortes der Bestattung haben wir, die Städte Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen, eine Gedenkstätte errichtet, der wir den Namen „Wege der Erinnerung“ gegeben haben.
Und wenn Sie alle nun aus diesem Anlass hier sind, lassen sich selbstredend aus dem Tagungstitel die beiden Fragen ableiten:
Welchen Anspruch haben wir mit unserer Gedenkstätte?
Wie ist die Wirklichkeit der Umsetzung unseres Anspruches?
Und genau diesen beiden Fragen nachzugehen, das war mein erster Reflex, als ich das Thema der Tagung gelesen habe. Bis zum vergangenen Sonntag war ich auch davon überzeugt, dass ich genau in dieser Interpretation heute Abend mit diesem Grußwort zu Ihnen sprechen werde.
Dann kam der vergangene Montag sowie der vergangene Dienstag.
Am vergangenen Montag hatten wir Besuch an unserer Gedenkstätte. Eine Begegnung mit den drei Söhnen des überlebenden Häftlings Nedo Fiano aus Mailand gemeinsam mit dem italienischen Filmemacher Ruggero Gabbai. Nedo Fiano ist vor fünf Jahren im Alter von 95 Jahren verstorben. Der Grund des Besuches war, dass über das Leben von Nedo Fiano ein Dokumentarfilm gedreht wird. Gedreht wurde am Montag auch an unserer Gedenkstätte.
In einer kurzerhand abgedrehten Interview-Szene hat mich der Regisseur unter anderem nach dem Anspruch gefragt, den wir mit unserer Gedenkstätte haben. „Welches Ziel verfolgen Sie?“, war seine Frage.
Anspruch!
Dann kam der Dienstag. An diesem Abend war ich von RIAS Baden-Württemberg, der erst neu gegründeten Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Baden-Württemberg eingeladen zu Vorstellung des Jahresberichtes Antisemitische Vorfälle in Deutschland 2024 des Bundesverbandes.
Die Rahmenbedingungen zu dieser Abendveranstaltung waren: der Veranstaltungsort wurde erst nach entsprechend personalisierter Anmeldung bekanntgegeben. Es war die Synagoge Mannheim. Sicherheit außen, inhaltlich eine Fallzunahme von 77%. Die Zahl der Anwesenden beziffert sich unter 30 Personen.
Wirklichkeit!
Nach diesen beiden Begebenheiten, die erst wenige Tage, ja Stunden, zurückliegen und die mich inhaltlich immer noch tief bewegen, bin ich zu einer anderen Interpretation des Themas dieser Tagung gelangt. Nämlich:
Welchen Anspruch haben wir an unsere Gedenkstättenarbeit in der heute aktuellen Wirklichkeit?
Unsere Gedenkstätte „Wege der Erinnerung“ ist Erinnerungsort, Gedenkort und Bildungsort. Darin gestützt wird sie durch historische Forschung und die Arbeit unserer ebenfalls gemeinsamen Gedenkstiftung.
In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben wir eine besondere Form der Erinnerungskultur entwickelt, in enger Kooperation mit der IRGW. Jährlich stattfindende Gedenkfeiern am jüdischen Holocaust-Gedenktag, dem Jom Hashoah, darin eingeschlossen eine religiöse Feier mit Mitgliedern der jüdischen Gemeinde Stuttgart unter der Leitung eines Rabbiners.
Wir leisten damit einen Beitrag, dass sich die menschenverachtenden Unrechtstaten des NS-Regimes nicht wiederholen.
Aber, wir haben seit dem 7. Oktober 2023 eine neue Situation. Wir haben ein konkretes Datum, das für einen Überfall steht. Beides beschreibt für Jüdinnen und Juden in Deutschland und weltweit eine neue Zäsur, ein neues „Davor“ und ein neues „Danach“.
Eine neue Situation, die Gedenkstätten auch als Politikort herausfordern und sie auch vermehrt zu Tatorten werden.
„Anspruch und Wirklichkeit“ – Inmitten antisemitischer Vorfälle, die alltagsprägend sind für Betroffene, die sie ansehen müssen in antisemitischen Versammlungen und erleben müssen an Schulen, Hochschulen, am Arbeitsplatz und in Sozialen Medien. Und das in allen Antisemitismusformen, die wir kennen. Israelbezogener Antisemitismus, Post-Schoa-Antisemitismus, Antisemitisches Othering, Moderner Antisemitismus und Antijudaistischer Antisemitismus.
Anspruch und Wirklichkeit!
Aus all dem bin ich sehr dankbar, dass es erstmals eine Kooperation zwischen den beiden Städten und der Akademie der Diözese Rottenberg in Hohenheim gibt und die sich aufgrund der Nähe ja geradezu anbietet. Darin schließe ich die Berührungspunkte zum Referat Geschichte der Akademie Hohenheim mit ein.
Ich schließe mit dem Dank an die Kooperationspartner, die Akademie Hohenheim, die Landeszentrale für politische Bildung sowie den Verbund der Gedenkstätten im ehem. KZ-Komplex-Natzweiler, dem auch Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen angehören. Nur dadurch wurde eine Tagung in dieser Größenordnung, d.h. mit Übernachtungsmöglichkeit und Verpflegung sowie einer entsprechenden technischen Ausstattung mit Online-Übertragung möglich.
Ihnen allen danke ich für Ihr Hiersein und wünsche uns allen einen Abend, der uns Inhalte für den Anspruch und Haltung für die Wirklichkeit gibt.
Vielen Dank.